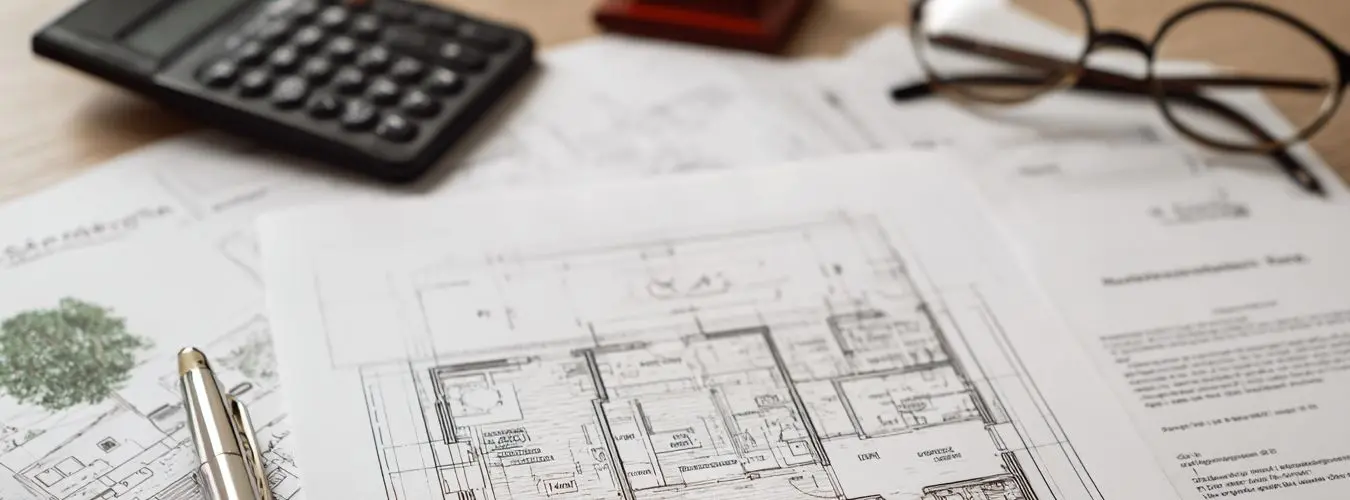Die Kündigungsfrist bei Mietwohnungen gehört zu den zentralen Fragen im Mietrecht. Sowohl Mieter als auch Vermieter sind an klare gesetzliche Vorgaben gebunden, die sich teilweise stark unterscheiden. Dieser Beitrag bietet einen umfassenden Überblick – von den gesetzlichen Grundlagen über Sonderkündigungsrechte bis hin zu wichtigen Formvorschriften.
Das Wichtigste zusammengefasst:
- Mieter: können unabhängig von der Wohndauer mit 3 Monaten Frist kündigen (§ 573c Abs. 1 BGB). Ausnahmen bestehen bei Mindestmietdauern.
- Vermieter: dürfen nur kündigen, wenn ein berechtigtes Interesse besteht (Eigenbedarf, Pflichtverletzungen des Mieters oder eine wirtschaftliche Verwertung). Die gesetzlichen Kündigungsfristen richten sich in diesen Fällen nach der Mietdauer:
- bis 5 Jahre: 3 Monate
- über 5 bis 8 Jahre: 6 Monate
- über 8 Jahre: 9 Monate
- Sonderkündigungen: bei Mieterhöhung, Modernisierung, Tod des Mieters oder im Zweifamilienhaus gelten spezielle Regeln.
- Eigenbedarf: nur mit nachvollziehbaren Gründen erlaubt, Missbrauch führt zu Schadensersatz.
- Sperrfristen (§ 577a BGB): bei Umwandlung in Eigentum gilt in vielen Städten ein Kündigungsschutz von bis zu 10 Jahren.
Kündigungsfristen im Überblick
Die gesetzlichen Kündigungsfristen im Mietrecht unterscheiden sich deutlich zwischen Mietern und Vermietern. Der folgende Überblick zeigt die wichtigsten gesetzlichen Regelungen.
Kündigungsfrist für Mieter
Für Mieter ist die Lage einfach: Laut § 573c BGB beträgt die Kündigungsfrist unabhängig von der Wohndauer drei Monate. Ausnahmen bestehen bei Mindestmietdauern.
Kündigungsfristen für Vermieter
Kündigungsfristen für Vermieter (ausschließlich möglich, wenn ein berechtigtes Interesse besteht):
- bis 5 Jahre: 3 Monate
- über 5 bis 8 Jahre: 6 Monate
- über 8 Jahre: 9 Monate
Damit ist klar: Je länger ein Mieter in der Wohnung wohnt, desto stärker ist sein Kündigungsschutz.
Eigenbedarfskündigung: Voraussetzungen und Grenzen
Die Eigenbedarfskündigung ist der häufigste Kündigungsgrund von Vermieterseite. Sie ist jedoch nur wirksam, wenn ein nachvollziehbarer Grund vorliegt. Zulässig ist Eigenbedarf zum Beispiel für den Vermieter selbst, Ehe- oder Lebenspartner, Kinder, Enkel, Eltern oder Geschwister. Auch für Pflegepersonal kann Eigenbedarf geltend gemacht werden, sofern ein enges persönliches Verhältnis besteht.
Entscheidend ist die Begründung. Eine pauschale Aussage wie „ich brauche die Wohnung für ein Familienmitglied“ reicht nicht aus. Der Vermieter muss detailliert darlegen, wer genau einziehen soll, warum die bisherige Wohnsituation nicht ausreicht und weshalb gerade diese Wohnung benötigt wird. Andernfalls droht die Kündigung unwirksam zu sein.
Missbräuchlich ausgesprochene Eigenbedarfskündigungen können gravierende Folgen haben: Der Mieter darf Widerspruch einlegen, Schadensersatz für Umzugskosten verlangen und im Extremfall sogar die Rückgabe der Wohnung einfordern, wenn der angebliche Eigenbedarf nie realisiert wird.
Härtefallregelung nach § 574 BGB
Selbst wenn ein Eigenbedarf rechtlich besteht, kann der Mieter der Kündigung widersprechen. Das Gesetz sieht eine Härtefallregelung vor, wenn der Auszug für den Mieter unzumutbar wäre. Beispiele sind hohes Alter, schwere Krankheit, eine fortgeschrittene Schwangerschaft, der bevorstehende Schulabschluss eines Kindes oder der nachweisliche Mangel an Ersatzwohnraum. In solchen Fällen entscheiden Gerichte häufig zugunsten des Mieters.

Sonderkündigungsrechte für Mieter und Vermieter
Neben den regulären Kündigungsfristen kennt das Mietrecht eine Reihe von Sonderregelungen:
- Mieterhöhung (§ 561 BGB): Erhöht der Vermieter die Miete, können Mieter bis zum Ende des zweiten Monats nach Zugang kündigen, und zwar zum Zeitpunkt, an dem die Mieterhöhung wirksam werden würde.
- Modernisierung (§ 555e BGB): Wird eine Modernisierung angekündigt, können Mieter das Mietverhältnis bis zum Ende des Monats nach Zugang der Mitteilung außerordentlich kündigen.
- Tod des Mieters (§ 580 BGB): Stirbt der Mieter, können Erben oder Vermieter innerhalb eines Monats nach Kenntnis außerordentlich kündigen.
- Zweifamilienhaus (§ 573a BGB): Vermieter, die selbst im Haus wohnen und eine zweite Wohnung vermieten, können ohne Angabe eines Kündigungsgrundes kündigen. Die Frist verlängert sich allerdings um drei Monate.
Sperrfristen nach Umwandlung (§ 577a BGB)
Ein besonders starker Schutz gilt, wenn Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden. In diesem Fall darf eine Eigenbedarfskündigung nicht sofort ausgesprochen werden. Nach § 577a BGB gilt eine Sperrfrist von mindestens drei Jahren. In vielen Städten mit angespanntem Wohnungsmarkt haben die Bundesländer diese Frist sogar auf bis zu zehn Jahre verlängert. Damit soll verhindert werden, dass Mieter kurzfristig verdrängt werden, sobald Wohnungen privatisiert werden.
Form und Zustellung: Worauf zu achten ist
Eine Kündigung muss stets schriftlich erfolgen und eigenhändig unterschrieben sein. E-Mail, Fax oder WhatsApp sind unwirksam. Empfehlenswert ist die Zustellung per Einschreiben mit Rückschein oder durch einen Boten.
Besonders wichtig ist die Drittwerktagsregel: Damit die Kündigungsfrist bereits mit dem laufenden Monat beginnt, muss das Schreiben dem Vertragspartner spätestens am dritten Werktag dieses Monats zugehen.

Praktische Checkliste für Mieter
- Kündigungsschreiben mit Absender, Adresse und Datum versehen
- Betreff: „Kündigung des Mietvertrags für [Adresse]“
- Hinweis auf die gesetzliche Kündigungsfrist von drei Monaten aufnehmen
- eigenhändige Unterschrift aller Vertragspartner
- Zustellung per Einschreiben oder Bote sicherstellen
Tipp: Ein Musterbrief erleichtert die formgerechte Kündigung und hilft, Fehler zu vermeiden.
Wann muss ein Mieter nach der Kündigung ausziehen?
Nach einer Kündigung des Mietverhältnisses muss der Mieter grundsätzlich bis zum Ende der im Kündigungsschreiben genannten Frist aus der Wohnung ausziehen. Die Kündigungsfrist bei unbefristeten Mietverträgen richtet sich in Deutschland meist nach den gesetzlichen Regelungen im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB):
- Bei Kündigung durch den Vermieter (nur bei berechtigtem Interesse möglich) richtet sich die Kündigungsfrist nach der Mietlänge (§ 573c BGB).
- Bei Kündigung durch den Mieter beträgt die Kündigungsfrist normalerweise drei Monate (§ 573c BGB). Ausnahmen bestehen bei Mindestmietdauern.
Das genaue Datum, bis wann der Mieter ausziehen muss, ist der letzte Tag der Kündigungsfrist.
Wichtige Punkte:
- Die Frist beginnt immer mit Zugang der Kündigung beim Mieter.
- Wenn der Mieter nicht fristgerecht auszieht, kann der Vermieter eine Räumungsklage einreichen.
- Bei einer außerordentlichen (fristlosen) Kündigung muss der Mieter unverzüglich, spätestens innerhalb der im Kündigungsschreiben genannten Frist ausziehen.
Beispiel:
Wenn die Kündigung am 1. April beim Mieter eingeht und eine Kündigungsfrist von 3 Monaten gilt, muss der Mieter spätestens am 30. Juni ausziehen.
Wie schreibt man eine Kündigung als Vermieter?
Als Vermieter müssen Sie bei einer Kündigung bestimmte formelle und rechtliche Vorgaben beachten. Hier sind die wichtigsten Schritte:
Formelle Anforderungen
- Schriftform: Die Kündigung muss schriftlich erfolgen (handschriftlich unterschrieben per Brief).
- Fristen einhalten: Die gesetzlichen Kündigungsfristen richten sich nach der Mietdauer:
- bis 5 Jahre: 3 Monate
- über 5 bis 8 Jahre: 6 Monate
- über 8 Jahre: 9 Monate
- Kündigung: Nur bei berechtigtem Interesse möglich (Eigenbedarf, Pflichtverletzungen des Mieters oder eine wirtschaftliche Verwertung).
- Kündigungsgrund angeben
Inhalt des Kündigungsschreibens
- Namen und Adressen von Vermieter und Mieter.
- Datum des Schreibens.
- Konkrete Angabe der gekündigten Wohnung (Adresse, Mietvertragsdatum).
- Kündigungstermin (z. B. „zum 30.11.2024“).
- Begründung mit Nachweis (z. B. Mahnungen bei Mietausfall).
- Hinweis auf Rückgabe der Wohnung (Schlüsselübergabe, Übergabeprotokoll).
Zustellung
Per Einschreiben mit Rückschein oder persönlich gegen Empfangsbestätigung.
Mustertext (Beispiel)
„Sehr geehrte(r) [Name des Mieters],
hiermit kündige ich den Mietvertrag vom [Datum] für die Wohnung [Adresse] zum [Kündigungstermin].
Die Kündigung erfolgt wegen [z. B. wiederholtem Zahlungsverzug gemäß § 543 Abs. 2 Nr. 3 BGB / Eigenbedarf gemäß § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB].
Als Nachweis füge ich [z. B. Kopien der Mahnschreiben / Nachweis des Eigenbedarfs] bei. Bitte übergeben Sie die Wohnung geräumt und besenrein bis zum [Datum].
Mit freundlichen Grüßen,
[Ihr Name/Vermieter].“
Wichtig:
- Rechtsberatung bei Unsicherheit (z. B. durch Anwalt oder Mieterverein).
- Landesrecht kann abweichen (z. B. in Berlin bei Eigenbedarf).
Fazit
Die Kündigungsfrist bei Wohnungen ist klar geregelt – für Mieter einfach, für Vermieter komplexer. Während Mieter jederzeit mit drei Monaten kündigen können (Ausnahme Mindestmietdauer), müssen Vermieter ein berechtigtes Interesse haben und gestaffelte Fristen sowie strengere Voraussetzungen beachten. Besonders wichtig sind die Eigenbedarfskündigung und zahlreiche Sonderregelungen. Wer eine Kündigung ausspricht oder erhält, sollte daher Fristen, Formvorschriften und Härtefallregelungen genau prüfen.